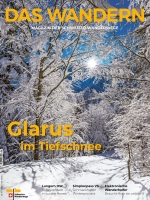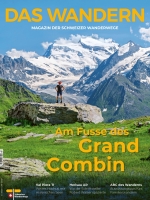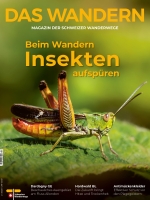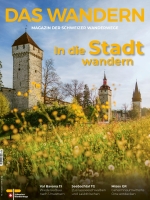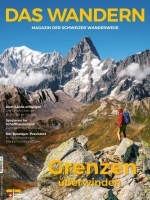Letzthin war ich mit meinem Neffen unterwegs, und die einzige Möglichkeit, wie wir vom Fleck kamen, war, wenn ich mich verhielt wie ein Pferd. Ich wieherte und trabte also mit ihm auf dem Rücken durch dunkle Wälder, überquerte reissende Flüsse und sprang über gefährliche Felsspalten. Bei den im hohen Gras versunkenen Schafen musste der Reiter dringend absteigen und die Blumen am Wegrand untersuchen. Während ich an einer möglichst wirkungsvollen Steigerung unseres Spiels rumstudierte, kam ich ins Grübeln. Gamification – also die «Spielifizierung» von spielfremden Kontexten – wird oft eingesetzt, um dort Motivation und Produktivität zu steigern, wo es eigentlich keine gibt. Überlistete ich meinen kleinen Neffen gerade mit einer perfiden, im Grunde wirtschaftlichen Strategie?
Der Kulturhistoriker Johan Huizinga beschrieb in den 1930er-Jahren den Menschen als spielendes Wesen, als sogenannten Homo ludens. Er meint dort, dass aus dem Spiel die gesamte Kultur, also Rituale, Kunst, Recht, Religion und Krieg, hervorgeht; ihm nach ist das Spielen ein Grundimpuls des Menschseins. Das Spiel ist überall.
Es gibt eine Arbeit des Künstlers Francis Alÿs, in der er Kinderspiele auf öffentlichen Plätzen dokumentiert. Sein Videoarchiv «Children’s Games» ist auch auf seiner Website verlinkt, ich kann das sehr empfehlen. So unterschiedlich ihre Umgebungen und Gegebenheiten auch scheinen – überall sind die Kinder wahnsinnig ernsthaft in ihre eigenen Spielregeln vertieft.
Während ich wartete, malte ich mir mein persönliches Wanderspielbrett aus und schaute dabei von oben auf mich hinab: mein Neffe und ich zwei Figuren in einer abgesteckten Landschaft, der Wanderweg, Wald, Wasser und Ackerland, dort die versunkenen Schafe als Extrapunkte, hinten der Weiler mit dem bösen Hund, am Rand des Bretts unser Ziel. Als Wanderin bin ich Spielfigur oder Spielerin und vielleicht auch beides gleichzeitig. Die Regeln mache schliesslich ich – und gewinnen tu ich jedes Mal.